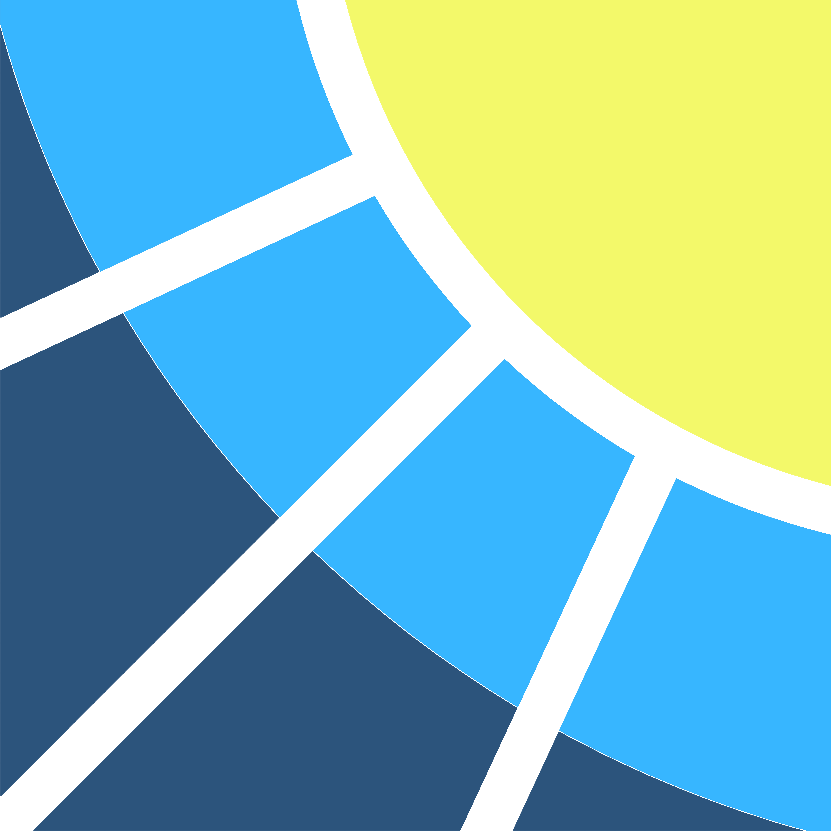Das Wichtigste zusammengefasst
- Der Wirkungsgrad einer Photovoltaik-Anlage sagt aus, wie effizient diese arbeiten kann.
- Verschiedene Arten von Solarzellen haben einen unterschiedlich hohen Wirkungsgrad.
- Da der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Zellen unter standardisierten Testbedingungen gemessen wird, lässt er sich in der Praxis nicht erreichen.
- Um einen hohen Ertrag zu erzielen, ist es entscheidend, auch den Wirkungsgrad der anderen Komponenten, einschließlich Wechselrichter und Verkabelung, der Solaranlage zu beachten.
Was ist der Photovoltaik-Wirkungsgrad?
Der Photovoltaik-Wirkungsgrad wird in Prozent angegeben und beschreibt das Verhältnis von nutzbarer zu zugeführter Energie. Bei einer Photovoltaik-Anlage sagt er aus, wie viel der eingestrahlten Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt werden kann. In diesem Kontext spricht man auch von der Effizienz der Photovoltaikmodule.
Da bei der Umwandlung von einer Energieform in eine andere zwangsläufig Verluste entstehen, ist es unmöglich, einen Wirkungsgrad von 100 Prozent zu erreichen. Für handelsübliche Solarzellen ist eine Energieausbeute beziehungsweise ein Wirkungsgrad von bis zu 25 Prozent unter idealen Betriebsbedingungen realisierbar.
Wie wird der Wirkungsgrad von Solarzellen gemessen?
Der Wirkungsgrad von Solarzellen wird unter standardisierten Testbedingungen im Labor ermittelt. Hersteller geben den Modulwirkungsgrad in Prozent nach STC (Standard Test Conditions) oder NOCT (Normal Operating Cell Temperature) an.
Bei der Bestimmung des Wirkungsgrads wird die Solarzelle mit Licht bestrahlt und die maximal erreichbare Leistung gemessen. Diese Maximalleistung wird durch die eingestrahlte Leistung gemäß STC dividiert und so der Wirkungsgrad der Solarzelle ermittelt.
Physikalische Grundlagen des Wirkungsgrads
Vielleicht wundern Sie sich, warum der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Anlagen nicht annähernd bei 100 Prozent liegt. Grund hierfür ist das Lichtspektrum der Sonne.
Nach dem Shockley-Queisser Limit können die Elektronen in Halbleiterkristallen nur von einem Teil des einfallenden Lichts mobilisiert werden und so zur Umwandlung in elektrische Energie durch den photoelektrischen Effekt beitragen. Der Rest hingegen wird in Wärmeenergie umgewandelt.
Solarzellen können demnach, je nach Modulart, nur einen bestimmten Teil des Sonnenlichts in Energie umwandeln. Mono- und polykristalline Zellen können beispielsweise nur das sichtbare Licht nutzen, das etwa 30 Prozent der Sonnenstrahlung ausmacht. Aus diesem Grund ist eine Effizienz von mehr als 30 Prozent nicht erreichbar. Diese Begrenzung betrifft jedoch nur Halbleiterkristalle mit einem Materialübergang.
Arten von Solarzellen und ihre Wirkungsgrade
Zu den am weitesten verbreiteten Modularten für Solaranlagen zählen monokristalline und polykristalline Solarzellen. Monokristalline Zellen erreichen in der Praxis einen Wirkungsgrad von 18 bis 24 Prozent, polykristalline Module dagegen von etwa 14 bis 20 Prozent. Daneben sind Dünnschichtmodule aus amorphem Silizium mit einem Wirkungsgrad von 10 bis 14 Prozent weit verbreitet. Aufgrund ihres geringeren Herstellungspreises kommen sie insbesondere in großen Solarparks zum Einsatz.
Daneben werden heutzutage auch Dünnschichtmodule aus anderen Materialien wie beispielsweise CIGS- und CdTe-Module mit einem Wirkungsgrad von bis zu 20 Prozent produziert. Forscher entwickeln zudem laufend neue, effektivere Module. Zu den weiteren verfügbaren Zellarten gehören beispielsweise Perowskit-Zellen, Tandemzellen, Mehrfachsolarzellen, Konzentratorzellen und amorphe, also besonders flexible Zellen beziehungsweise Module.
Wie beeinflussen Umweltfaktoren den Wirkungsgrad?
In der Realität wird der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Modulen von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören insbesondere:
Degradation von Solarzellen: Wirkungsgradverlust über die Jahre
Im Laufe der Zeit kommt es zwangsläufig zu einer Degradation beziehungsweise einem Leistungsabfall von Solarmodulen. Neben dem Alter der Module zeigen verschiedene Faktoren, wie die Neigung des Daches, die Umgebungstemperatur sowie Verschattungen, Auswirkungen auf die Degradationsrate.
Hersteller von Solarmodulen geben häufig eine Leistungsgarantie von 20 bis 30 Jahren. Die tatsächliche Lebensdauer der meisten Module beträgt jedoch 35 bis 40 Jahre.
In der Regel wird in den ersten 10 Jahren ein Leistungsverlust von maximal 10 Prozent, danach von maximal 20 Prozent garantiert. Demnach wird vorwiegend von einem jährlichen Leistungsverlust von höchstens 0,5 Prozent ausgegangen.
Technologische Innovationen zur Steigerung des Wirkungsgrads
Die moderne Innovationsforschung zeigt, dass einige neue Technologien großes Potenzial zur Steigerung des Solarstromertrags bergen. Dazu gehören beispielsweise Perowskit-Solarzellen aus sogenannten Halid-Perowskiten, die trotz günstiger Herstellungskosten einen theoretischen Wirkungsgrad von 34 Prozent ermöglichen.
Den bisherigen Weltrekord in der Solarenergieforschung halten jedoch Tandem-Solarzellen, mit denen in der Praxis bereits Wirkungsgrade von über 50 Prozent erzielt wurden. Durch die Stapelung verschiedener Materialien für verschiedene Anteile des Lichtspektrums bleibt ein kleineres Spektrum ungenutzt, wodurch dementsprechend mehr einfallende Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt werden kann.
Einfluss des Wirkungsgrads auf die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen
Der Wirkungsgrad eines Photovoltaik-Moduls beeinflusst direkt den Stromertrag und damit die Wirtschaftlichkeit der gesamten Solaranlage. Je höher die Stromproduktion, desto schneller lassen sich die Investitionskosten amortisieren. Dabei ist zu beachten, dass der angegebene Wirkungsgrad in der Praxis nicht vollständig erreicht werden kann. Der Return on Investment (ROI) hängt deshalb von zahlreichen Faktoren ab, insbesondere von einer fachgerechten Installation und regelmäßigen Wartung.
Wirkungsgrad nach 20 Jahren: Was ist realistisch?
Die Langzeitstabilität und Lebensdauer von Photovoltaikmodulen wird durch die Materialqualität und Umwelteinflüsse bestimmt. Die meisten Hersteller garantieren nach 20 Jahren einen maximalen Leistungsverlust von 15 bis 20 Prozent, was einer Restleistung von 80 bis 85 Prozent entspricht. Um die Degradation der Zellen zu minimieren, sind regelmäßige Reinigung und Wartung essenziell.
Modul-Wirkungsgrad vs. System-Wirkungsgrad: Wo liegen die Unterschiede?
Wichtiger als der Modul-Wirkungsgrad ist der Gesamtwirkungsgrad Ihrer Solaranlage. Dabei handelt es sich um die Gesamtleistung der Anlage inklusive all ihrer Komponenten – also den Solarmodulen, dem Wechselrichter, der Verkabelung und weiteren, möglichen Bestandteilen.
Um den System-Wirkungsgrad zu erhöhen, ist nicht nur ein hoher Wirkungsgrad der einzelnen Bestandteile, sondern auch eine gute Kompatibilität entscheidend. Zudem ist es empfehlenswert, die Anlage fachgerecht zu installieren, da sich so Effizienzverluste vermeiden lassen.
FAQ
Der maximale Wirkungsgrad für PV-Module ist wichtig, aber nicht der einzige entscheidende Faktor zur Beurteilung der Leistung.
Lichtverhältnisse, Temperatur, Ausrichtung und Verschmutzungen beeinflussen den Wirkungsgrad erheblich
Der Wirkungsgrad gibt die maximale Leistung unter Testbedingungen an, die Performance-Ratio das reale Verhältnis der Energieproduktion.
Quellen
https://photovoltaik.org/photovoltaikanlagen/solarzellen/photovoltaik-wirkungsgrad
https://priwatt.de/blog/wirkungsgrad-solarzellen-einfach-erklaert
https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/wirkungsgrad
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/degradation#c7597